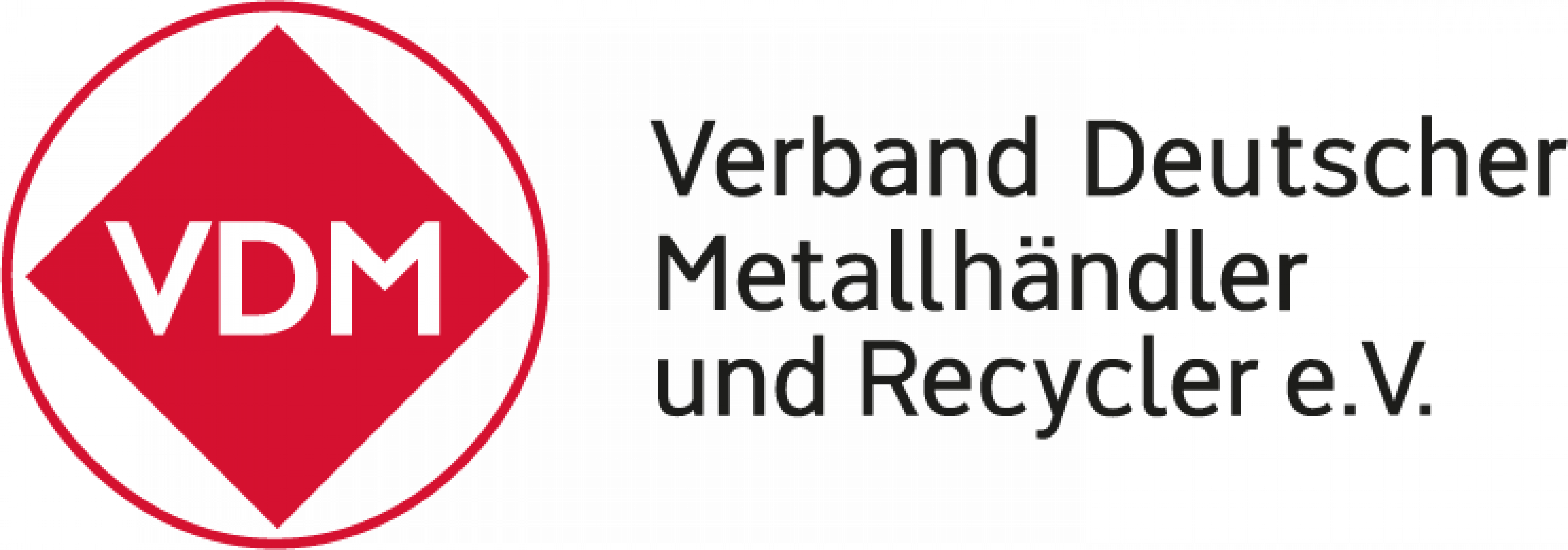Glossar
A
Altmetallhandel
Der Altmetallhandel ist die wichtigste metallische Rohstoffquelle Europas. Rund die Hälfte des in Deutschland produzierten Kupfers wird aus Altmetall gewonnen. Bei anderen Nicht-Eisen-Metallen (NE-Metalle) ist diese Quote ähnlich hoch.
Altmetall wird unterteilt in: Altschrotte, Neuschrotte und metallhaltige Rückstände. Ungeachtet der juristischen Einordnung in verschiedene Rechtsbereiche (Abfallrecht, Stoffrecht, Produktrecht), bleibt es zentrales Ziel der NE-Metallrecyclingwirtschaft, den Sekundärrohstoff Schrott in höchster Qualität zur Wiederverwendung dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung zu stellen.
Alt- und Neuschrotte
Altschrotte sind gebrauchte, nicht mehr verwendbare Metallteile. Das können beispielsweise Rohre, Stangen, Batterien, Altkabel, Elektro- und Elektronikschrott oder alte Teile aus Haushalt oder Abbruch sein.
Neuschrotte sind in der Regel Produktionsabfälle, also metallisches Material, das bei der Be- und Verarbeitung von Metallen und Erzeugnissen anfällt. Beispielhaft seien Späne sowie Stanz-, Blech- und Profilschrott genannt. Neuschrotte, die bei der Produktion anfallen und im eigenen Werk wiedereingesetzt werden, heißen Kreislaufschrotte. Auch nicht genutzte Erzeugnisse können Neuschrott sein. Metallhaltige Rückstände sind beispielsweise Aschen, Krätzen, Schlacken, Schlämme und Stäube, die Gehalte von aufbereitbaren Metallen oder deren Legierungen, zum Teil in gebundener Form, aufweisen.
Aluminium
Aluminium ist das bei weitem am häufigsten verarbeitete NE-Metall. Ausgangsmaterial zur Aluminiumherstellung ist das Erz Bauxit. Hauptlagerstätten liegen in Australien, Westafrika, Jamaika und Brasilien. Gewichtsersparnis, Stabilität, Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse zeichnen dieses Metall aus.
Mit einer Häufigkeit von 7,57 Gewichtsprozent ist Aluminium nach Sauerstoff und Silicium das dritthäufigste Element der Erdkruste und das häufigste Metall. Es weist nach Silber, Kupfer und Gold die höchste elektronische Leitfähigkeit auf. Die Festigkeit des reinen Aluminiums ist relativ gering, durch Zusatz von Legierungselementen kann die Festigkeit jedoch deutlich erhöht werden. Der leichte und doch feste, rostfreie Werkstoff verringert das Eigengewicht von Autos, Schienenfahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen. Damit trägt er dazu bei, Energie zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Aluminium kommt aber auch im Haus zum Einsatz bei Fenstern, Fassaden, Dächern und Treppen. Man findet Aluminium im gesamten Alltag – sei es die Bratpfanne, Schilder oder in Form von Verpackungen, wie Dosen oder Folien, die unsere Lebensmittel frisch halten.
B
Blei: Recycling
Blei ist ein chemisches Element mit dem Symbol Pb und der Ordnungszahl 82 im Periodensystem. Es handelt sich um ein schweres Metall, das in der Natur häufig in Form von Erzen wie Galenit (Bleiglanz) vorkommt. Blei ist seit langem bekannt und wurde in verschiedenen Anwendungen verwendet, sowohl aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften als auch aufgrund seiner chemischen Stabilität.
Die Eigenschaften von Blei als Werkstoff werden auch nach der Nutzung in einem Produkt nicht beeinträchtigt. Blei kann daher bei entsprechender Aufbereitung beliebig oft und ohne Qualitätsverlust wiederverwertet werden.
C
Cadmium
Cadmium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Cd und der Ordnungszahl 48 im Periodensystem. Es ist ein weiches, silberweißes Metall, das in der Natur häufig als Nebenprodukt bei der Zinkgewinnung vorkommt. Cadmium hat einige Verwendungsmöglichkeiten, wird jedoch aufgrund seiner Toxizität und Umweltauswirkungen zunehmend eingeschränkt.
Eine der Hauptverwendungen von Cadmium ist in Nickel-Cadmium-Akkumulatoren (NiCd-Akkus), die aufgrund ihrer hohen Energiedichte und langlebigen Leistung in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Cadmium wird auch in der Elektronikindustrie für die Herstellung von Lötlegierungen, Kontakten und Schaltern verwendet. Aufgrund seiner guten Korrosionsbeständigkeit findet Cadmium Anwendung in Beschichtungen, insbesondere in der Luftfahrt- und Automobilindustrie, um Korrosionsschutz zu bieten.
D
E
Elektroaltgeräte
Bis in die 70er Jahre verstand man unter Elektroaltgeräten defekte elektrische Haushalts-, Radio- und Fernsehgeräte. Elektronikaltgeräte kamen erst später dazu. In den 1980er Jahren veränderte sich die Zusammensetzung des Abfallstroms mit dem Siegeszug der Computertechnologie dramatisch. Obwohl Elektronik- und Elektroschrott rein rechtlich Abfall darstellt, sind Elektroaltgeräte eine wichtige Rohstoffquelle, die wertvolle Metall- und Eisenfraktionen enthält. Diese in den Geräten enthaltenen NE-Metalle werden von den Mitgliedsunternehmen des VDM Verbandes Deutscher Metallhändler und Recycler ebenso recycelt wie Kunststoffe oder andere Materialfraktionen. Dabei hat Umweltschutz oberste Priorität. Den rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Elektroaltgeräten bildet die Europäische Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE), welche in Deutschland und Österreich durch ergänzende nationale Vorschriften umgesetzt wurde.
Qualitätsgemeinschaft Elektroaltgeräte
In der Qualitätsgemeinschaft Elektroaltgeräte sind diejenigen Mitgliedsunternehmen des VDM organisiert, die die umweltgerechte Erfassung und das Recycling von Elektronik- und Elektroschrott zu ihrem Schwerpunkt gemacht haben. Die Gruppe repräsentiert den Handel ebenso wie Recyclingbetriebe und Hütten. Sie bildet ein dichtes Netzwerk zur Bewältigung der logistischen Herausforderungen von Herstellern und Handel sowie zur flächendeckenden Entsorgung.
RECYCLING VON ELEKTRONIK- UND ELEKTROSCHROTT
Kürzere Produktlebenszeiten und höhere Innovationsgeschwindigkeiten führen zu kontinuierlich wachsenden Elektronikschrottmengen. Jährlich werden allein in Deutschland rund zwei Millionen Tonnen Elektronikgeräte in den Verkehr gebracht. Denn die Zeit seit der Jahrtausendwende steht ganz im Zeichen des Mobilfunks und der nahezu kompletten elektronischen Vernetzung: Mitte 2015 waren allein in Deutschland 46 Millionen Smartphones im Einsatz, Tendenz steigend.
Elektroschrott-Recycling: Gewinnung von Wertstoffen
Ziel der Mitgliedsunternehmen des VDM ist, metallhaltige Abfälle wie Elektronik- und Elektroschrott aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen derart aufzuarbeiten, dass eine größtmögliche Menge an Wertstoffen gewonnen und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden kann. Zahlreiche Faktoren (beispielsweise Standortbedingungen) bilden für die Betriebe eine entscheidende Rolle, wenn es um die Entwicklung der besten Technik zur Entsorgung von Elektronik- und Elektroschrott geht. Die komplexen Aufbereitungsanlagen für Elektroaltgeräte können eine große Bandbreite an Inputmaterial effektiv behandeln und die am Markt nachgefragten Materialqualitäten erzeugen.
Entsorgungsfachbetrieb
- Gemäß § 56 II KrWG ist der Entsorgungsfachbetrieb ein Betrieb, der gewerbsmäßig, im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen, Abfälle sammelt, befördert, lagert, behandelt, verwertet, beseitigt, mit diesen handelt oder makelt und
- in Bezug auf eine oder mehrere der in Nummer 1 genannten Tätigkeiten durch eine technische Überwachungsorganisation oder eine Entsorgergemeinschaft als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist.
Entsorgungsfachbetriebe bieten eine hohe Gewähr für einen sach- und umweltgerechten Umgang mit Abfällen und stellen im Rahmen der Produktverantwortung einen wichtigen Schutz für Lieferanten und Abnehmer dar. In vielen Ausschreibungen ist eine entsprechend Zertifizierung unerlässliche Teilnahmevoraussetzung.
F
Ferrolegierungen
Als Ferrolegierung werden Legierungen mit Eisen als Trägermaterial und einem oder mehreren Zusatzelementen (NE-Metalle) bezeichnet. Ferrolegierungen lassen sich in drei Kategorien unterteilen. In die sog. Massenlegierungen, die Nobellegierungen sowie die Speziallegierungen (auch genannt Superlegierungen).
Massenlegierungen stellen die Grundversorgung von Stahlwerken dar. Dazu zählen u.a.: Ferrosilicium, Ferro-Mangan, Silicium-Mangan und Ferro-Chrom. Grundsätzlich sorgen die Zusatzelemente für eine erhöhte Zugfestigkeit, Streckgrenze und Zunderbeständigkeit beim Stahl. Chrom ist der wichtigste Bestandteil nichtrostender Stähle, er erhöht insbesondere die Korrosionsfestigkeit. Ferro-Silicium wird eingesetzt als Reduktionsmittel in Stahlschmelzen, die Schmelze wird dünnflüssiger. Ferro-Mangan ist ein günstiges und wirkungsvolles Legierungselement zur Verbesserung der Härtbarkeit und Durchhärtung. Je höher der Mangan-Gehalt, desto niedriger ist die kritische Abkühlgeschwindigkeit und so höher ist die Einhärtung.
Nobellegierungen sind Ferro-Molybdän, Ferro-Vanadium, Ferro-Wolfram,
Ferro-Titan sowie Ferro-Niob. Im Gegensatz zu den Massenlegierungen ist der Mengenanteil der NE-Metalle in den Nobellegierungen geringer. Allerdings bedeuten einige wenige Prozent in einer Legierung oftmals schon eine erhebliche Verbesserung. Aufgrund von seltenerem Vorkommen und höherer Förder- und Produktionskosten ist der Preis für die Nobellegierungen höher als bei den Massenlegierungen.
Ferro-Molybdän
Ferro-Molybdän ist sehr hart und zäh, was die Härtbarkeit und Zugfestigkeit verbessert. Hohe Molybdän-Gehalte senken die Korrosionsanfälligkeit. Häufiger Anwendungsbereich ist der Einsatz bei hochlegierten Chrom- und Chrom-Nickel-Stählen.
Ferro-Titan
Ferro-Titan wird oft als Stabilisator in korrosionsbeständigen Stählen verwendet und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit in Bezug auf Salzsäure, chloridhaltige Lösungen & Schwefelsäure aus.
Ferro-Vanadium
Ferro-Vanadium erhöht sowohl den Verschleißwiderstand als auch die Warmfestigkeit und dient als Zulegierung zu Schnellarbeits-, Warmarbeits- & Hochwarmfeststahl. Es hat in weiten Bereichen ähnliche metallurgische Eigenschaften wie Ferro-Niob.
Ferro-Niob
Ferro-Niob wirkt im Grunde genommen als „Metallschützer“ (da nahezu resistent gegenüber Fremdeinwirkungen wie Säuren) und kann in der Stahlmetallurgie in weiten Bereichen Ferro-Vanadium ersetzen. Es erhöht die Beständigkeit, verbessert die Schweißbarkeit. Nickel-Niob und Ferro-Niob werden auch genutzt zur Herstellung von Superlegierungen in der Raumfahrt für Raketenteile oder andere Hochtemperaturanwendungen (z.B. spezielle Öfen). Eingesetzt werden diese Legierungen auch in bestimmten Kondensatoren, Halogenlampen und Katalysatoren sowie in Atomkraftwerken bzw. Teilchenbeschleunigern.
Ferro-Wolfram
Ferro-Wolfram dient der Erhöhung sowohl der Streckgrenze als auch der Zähigkeit, sowie Zug-, Warm- und Verschleißfestigkeit. Die Legierung wird als Zusatz bei Schnell- und Warmarbeitsstahl eingesetzt.
Superlegierungen
Superlegierungen haben eine noch komplexere (z.T. von Elementen, die lange Zeit als nicht mischbar galten wie z.B. Fe und Al) Zusammensetzung (eine Basis aus Eisen, Nickel, Platin, Chrom oder Kobalt mit Zusätzen wie Kobalt, Nickel, Eisen, Chrom, Molybdän, Wolfram, Rhenium, Tantal, Niob, Aluminium, Titan, Mangan, Zirconium und/oder Bor) und sind vor allem für Hochtemperaturanwendungen vorgesehen. Verbreitet sind vor allem Superlegierungen auf Nickel-Basis und Kobalt-Chrom-Basis. Superlegierungen finden vorwiegend Anwendung im Motoren-, Turbinen- und Triebwerksbau, in der Energietechnik sowie in Luft- und Raumfahrt.
G
Germanium
Germanium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ge und der Ordnungszahl 32 im Periodensystem. Es handelt sich um ein graues, halbmetallisches Element, das in der Natur selten vorkommt. Germanium hat einige einzigartige Eigenschaften, die es in verschiedenen Anwendungen nützlich machen.
H
I
Indium
Indium ist ein chemisches Element mit dem Symbol In und der Ordnungszahl 49 im Periodensystem. Es handelt sich um ein silberweißes, weiches Metall, das in der Natur selten vorkommt. Indium hat einige einzigartige Eigenschaften, die es in verschiedenen Anwendungen äußerst wertvoll machen.
Aufgrund seiner geringen Toxizität und seiner Fähigkeit, bei niedrigen Temperaturen zu schmelzen, wird Indium in der Elektronikindustrie häufig für die Herstellung von Lötpasten und -legierungen verwendet. Es dient als eine wichtige Komponente in Flachbildschirmen, da es eine hohe elektrische Leitfähigkeit und Lichtdurchlässigkeit besitzt. Indiumverbindungen werden auch in der Photovoltaikindustrie für die Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen verwendet, um Sonnenenergie effizienter zu nutzen. Darüber hinaus findet Indium Anwendung in der Halbleiterindustrie, in Beschichtungen für Spiegel und in der Hochvakuumtechnologie.
J
K
Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept, das darauf abzielt, den Verbrauch von Ressourcen zu minimieren und Abfälle zu reduzieren, indem Materialien und Produkte in geschlossenen Kreisläufen gehalten werden. Anstatt die herkömmliche lineare Wirtschaftsweise zu verfolgen, bei der Rohstoffe gewonnen, zu Produkten verarbeitet und anschließend entsorgt werden, zielt die Kreislaufwirtschaft darauf ab, Ressourcen zu erhalten und ihre Nutzungsdauer zu verlängern.
In der Kreislaufwirtschaft werden Materialien gesammelt, sortiert, recycelt und in neuen Produkten wiederverwendet. Dadurch wird der Bedarf an neuen Rohstoffen reduziert und die Umweltauswirkungen der Ressourcengewinnung verringert.
Das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, einen nachhaltigen und effizienten Umgang mit Ressourcen zu ermöglichen, die Abfallmenge zu minimieren und Umweltbelastungen zu reduzieren. Sie bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern kann auch wirtschaftliche Chancen schaffen, indem sie Arbeitsplätze in den Bereichen Recycling, Reparatur und Wiederverwertung schafft. Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Ansatz, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und eine ressourcenschonende Gesellschaft aufzubauen.
Kupfer
VORKOMMEN, GEWINNUNG, EIGENSCHAFTEN, VERWENDUNG
Kupfer, das rötliche Buntmetall kommt in der Natur als gediegenes Metall und in Mineralien vor. Zur Gruppe der größten Kupferproduzenten zählen die USA, Chile, Japan und China. Kupfer ist als relativ weiches Metall gut formbar und zäh. Als hervorragender Wärme- und Stromleiter findet Kupfer vielseitige Verwendung und zählt auch zur Gruppe der Münzmetalle. In Kraftfahrzeugen wird es für Bremsleitungen und elektrische Antriebe verwendet, im Bauwesen wird es als Dach-, Dachrinnen- und Fassadenmaterial eingesetzt. Kupfer wird genauso in Heizungsanlagen und bei Sanitärinstallationen genutzt, und wegen seiner Beständigkeit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch für die öffentliche Trinkwasserversorgung. So kommt es auch als Messing (Kupfer-Zink-Legierung) in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln für Haltegriffe
und Türklinken zum Einsatz, um die Übertragung von Krankheitskeimen zu verhindern, da viele Bakterien durch Kupfer im Wachstum gehemmt werden. Zudem ist Kupfer ein traditionelles Münzmaterial und auch bei der künstlerischen Gestaltung beliebter Werkstoff. Kupfer spielt insbesondere im menschlichen Stoffwechsel als lebenswichtiges Spurenelement eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung. Kupfer ist ein Metall, das beliebig häufig ohne Qualitätsverluste recycelbar ist. Mehr als 80 % des
jemals geförderten Kupfers sind heute noch im Kreislauf - es besteht sogar kaum ein Zweifel, dass Kupfer, das einst im alten Ägypten erschmolzen wurde, noch heute im Gebrauch ist. Kupfer- und Kupferlegierungsschrotte werden Hütten-, Schmelz- und Verarbeitungswerken zugeführt, die mit modernsten Produktions- und Umweltschutztechnologien arbeiten. Einen wesentlichen Anteil beim Kupferrecycling macht die Zerlegung von alten Kabeln und Leitungen aus. Sie verbergen unter ihrer Ummantelung einen Kern aus Kupfer von höchster Reinheit. Mühlen zerschneiden die alten Kunststoffkabel und –Leitungen in kleinste Teile. Umweltfreundliche
Verfahren trennen die entstehende Mischung aus Kunststoff und Kupfer und führen das rote Metall dem Kreislauf wieder zu. Auch das Kunststoffmahlgut erfährt eine sinnvolle Wiederverwertung. Einen weiteren großen Anteil an der Kupferrückgewinnung haben u. a. ausgediente Kupferrohre, Kupferstangen, Kupferbleche und –Bänder. Das Recycling von Kupfer kann als größte und wirtschaftlichste Kupfermine bezeichnet werden.
SCHON GEWUSST, DASS ...
- bei der Verbrennung von Kupfer die Flamme grün leuchtet?
- Kupfer wegen seiner toxischen Wirkung auf Bakterien als Münzmetall verwendet wird?
- Bronze aus einer Legierung von Kupfer und Zinn besteht?
L
LME - LONDON METAL EXCHANGE
Das Zentrum des internationalen Metallhandels ist London. Die Londoner Metallbörse (LME) ist für Metalle der wichtigste Handelsplatz – an ihr orientieren sich die Preise der NE-Metalle rund um den Globus. Gegenwärtig werden 11 verschiedene Metalle gehandelt. Nichteisen-Metalle, Minor Metals (sogenannte Nebenmetalle) und Stahl. Die Qualitätsanforderungen und die handelbaren Losgrößen sind in den jeweiligen Kontraktspezifikationen festgelegt, um einheitlichen Standard zu gewährleisten.
Die Kernfunktionen der LME
Die LME erfüllt im Wesentlichen drei Kernfunktionen: An der Börse werden täglich die international akzeptierten Metallpreise gebildet, die weltweit bei Produzenten, Händlern und Verarbeitern in ihren physischen Verträgen angewandt werden (Preisfindung). Durch Sicherungsgeschäfte (Hedging) kann in jeder Phase von Produktion, Verarbeitung, Handel und Verbrauch eine Sicherung vor Preisrisiken durch Termingeschäfte vorgenommen werden. Die LME verfügt über von ihr lizenzierte Lagerhäuser, in denen die gehandelten Metalle auch physisch aus- und eingelagert werden können (Lieferung). Darüber hinaus kann ein Anbieter von Metall dieses jederzeit zum aktuell geltenden Marktpreis über die LME verkaufen (market of last resort). Insgesamt bietet die Londoner Metallbörse drei Handels-Plattformen. Neben dem klassischen Ringhandel auch die elektronische Plattform LME-Select sowie den Telefonmarkt. Die Börse selbst ist nicht im Handel tätig. Sie stellt lediglich die Infrastruktur einer funktionsfähigen Börse zur Verfügung.
Weitere Metallbörsen
Neben der LME existieren noch vier weitere bedeutende Metallbörsen. Die COMEX in New York, die SIMEX in Singapur sowie die SHFE in Shanghai und die KLTM in Kuala Lumpur.
New York Mercantile Exchange, COMEX
Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, ICDX
Shanghai Futures Exchange, SHFE
Zinnbörse von Kuala Lumpur, KLTM
M
Metallrecycling
Metallrecycling spielt eine entscheidende Rolle bei der Schonung von Ressourcen und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der verarbeitenden Industrie weltweit. Durch das Recycling von Metallen können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden, wodurch sich der Bedarf an Primärrohstoffen wie Erzen und Mineralien verringert. Dadurch werden nicht nur natürliche Ressourcen geschont, sondern auch die mit dem Abbau und der Verarbeitung von Erzen verbundenen Umweltauswirkungen verringert.
Darüber hinaus trägt das Metallrecycling zur Einsparung von Energie und CO2-Emissionen bei. Die Aufbereitung von Metallen erfordert weniger Energie als die Gewinnung von Metallen bzw. Erzen aus Primärquellen. Durch den Einsatz von aufnereiteten Metallen anstelle von Erzen können erhebliche Mengen an Treibhausgasemissionen eingespart werden, die bei der Gewinnung, Verarbeitung und dem Transport von Primärmetallen entstehen würden. Das Metallrecycling spielt daher eine wichtige Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft.
Molybdän
Molybdän ist ein chemisches Element mit dem Symbol Mo und der Ordnungszahl 42 im Periodensystem. Es handelt sich um ein silbergraues, hartes Metall, das in der Natur vor allem in Form von Molybdänglanz vorkommt. Molybdän hat eine hohe Schmelztemperatur und ist extrem beständig gegen Hitze und Korrosion, wodurch es in verschiedenen Anwendungen von großer Bedeutung ist.
Molybdän wird häufig in der Stahlindustrie verwendet, wo es als Legierungselement beigemischt wird, um die Festigkeit und Härte von Stahl zu verbessern. Es erhöht auch die Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit von Stahl. Darüber hinaus findet Molybdän in der Elektronikindustrie Anwendung, insbesondere bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen wie Transistoren und Dioden. Aufgrund seiner hohen Schmelztemperatur wird Molybdän auch in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in Heizelementen, Schmelztiegeln und Raketendüsen.
N
NE-Metalle
Nichteisenmetalle (NE-Metalle) sind vereinfacht gesagt alle Metalle außer Eisen. Dazu gehören auch Metalllegierungen, in denen Eisen nicht als Hauptelement enthalten ist oder der Anteil an reinem Eisen (Fe) nicht mehr als 50 % beträgt.
Beispiele für Nichteisenmetalle sind Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn. Diese Metalle können auch unter dem Oberbegriff Grund- oder Industriemetalle zusammengefasst werden. Klassische NE-Legierungen sind z. B. Messing und Bronze. Nichteisenmetalle werden häufig auch als Buntmetalle bezeichnet. Hinzu kommen die so genannten Nebenmetalle und Seltenen Erden, die unter dem Oberbegriff Strategische Sondermetalle zusammengefasst werden.
Neumetallhandel
Neumetalle sind Metalle, die durch den Einsatz primärer oder sekundärer Rohstoffe erzeugt werden. Sie werden in handelsüblichen Formen angeboten, beispielsweise als Kathoden, Masseln oder Blöcke. Die mengenmäßig größte Rolle im Neumetallhandel spielen die sogenannten Basis- oder Industriemetalle:
Aluminium, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn. Der Bedarf an diesen Metallen und damit der Metallhandel steigen stetig. Konjunkturelle Schwächephasen verursachen lediglich einen vorübergehenden Marktrückgang, aber verändern den Trend letztlich nicht. Die Preisbildung dieser Metalle erfolgt an der LME.
Die Preise eines wichtigen Zweigs des Neumetallhandels bilden sich allerdings nicht an der LME: strategische Sondermetalle und Ferrolegierungen werden nicht an der LME gehandelt und unterliegen eigenen Preismechanismen.
Niob
Niob ist ein chemisches Element mit dem Symbol Nb und der Ordnungszahl 41 im Periodensystem. Es handelt sich um ein graues, glänzendes Metall, das in der Natur hauptsächlich in Form von Niobit (auch bekannt als Kolumbit) vorkommt. Niob besitzt einige bemerkenswerte Eigenschaften, die es für verschiedene Anwendungen besonders wertvoll machen.
Niob wird häufig in der Stahlindustrie verwendet, wo es als Legierungselement beigemischt wird, um die Festigkeit, Härte und Zähigkeit von Stählen zu verbessern. Es bildet sogenannte Niobcarbide, die dem Stahl eine hohe Warmfestigkeit verleihen. Darüber hinaus findet Niob in der Superleiter-Technologie Anwendung. Bei tiefen Temperaturen kann Niob seine elektrische Leitfähigkeit ohne jeglichen Widerstand aufrechterhalten, wodurch es für die Herstellung von supraleitenden Magneten, Elektromotoren und Beschleunigern verwendet wird. Supraleitende Nioblegierungen werden auch in der Medizintechnik eingesetzt, beispielsweise bei der Magnetresonanztomographie (MRT).
O
P
Q
Qualität
Durch das sammeln, sortieren und aufbereiten erfüllt die Recyclingwirtschaft ihre Qualitätsfunktion. Insbesondere bei komplexen Legierungen erfordert diese Arbeit ein besonderes Know-how, um die Produktion der Hütte während des Schmelzprozesses vor einer Fehlcharge zu bewahren. Hier wird deutlich, wie wichtig Erfahrung und Können des Handels sind, um den Qualitätsanforderungen der Industrie gerecht zu werden.
R
Reverse-Charge-Verfahren im Metallhandel
Viele steuerrechtliche Regelungen haben eine besondere Bedeutung für den Metall- und Schrotthandel. So sind Rechnungen beim Verkauf von Sekundär- und Neumetallen im Reverse-Charge-Verfahren zu stellen. Nach dieser umsatzsteuerlichen Regelung schuldet in bestimmten Fällen nicht der leistende Unternehmer, sondern der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer.
Eingeführt wurde dieses Verfahren, um Umsatzsteuerbetrug im Schrotthandel zu verhindern. Der VDM begrüßt dies, da Reverse-Charge steuerehrliche Unternehmen vor Umsatzsteuerbetrügern schützt. Kritisch ist indes, dass im Handel mit Neumetallen eine Bagatellgrenze von 5.000 EUR gilt, ab der Rechnungen im Reverse-Charge-Verfahren zu stellen sind. Im Schrotthandel gibt es diese Bagatellgrenze hingegen nicht.
S
Sach- und Fachkundelehrgänge nach EfBV
Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) verlangt in § 9 Abs. 2 Nr. 3, dass verantwortliche Personen in Entsorgungsfachbetrieben über fachliche Kenntnisse verfügen müssen. Daher müssen die für die Leitung und Beaufsichtigung von Entsorgungsfachbetrieben verantwortlichen Personen mindestens alle zwei Jahre einen staatlich anerkannten Sach- und Fachkundelehrgang besuchen. Die ESN bietet zu allen Terminen bzw. Veranstaltungen auch das Zusatzmodul Abfallbeauftragter an.
Seltene Erden
Seltene Erden werden oft mit den strategischen Sondermetallen durcheinandergebracht. Insgesamt geht es dabei um 17 Metalle. Dazu gehören z. B. Lanthan (Anwendung in der Glasindustrie zur Herstellung optischer Gläser), Neodym und Samarium (beide finden Anwendung in Hochleistungsmagneten). Einige Seltene Erden-Metalle sind so häufig wie Blei. Andere wie Thulium sind eher rar, indes ist dies aufgrund der geringen Relevanz weniger dramatisch. Die SE-Metalle sind trotz ihres vergleichsweise häufigen Vorkommens auf der Erde bisher nur an wenigen Stellen der Erdkruste in abbauwürdigen Mengen vorhanden.
Charakteristisch für Seltene Erden sind zwei Aspekte: Zum einen die Anwendungsvielfalt und außergewöhnlichen Eigenschaften und zum anderen die Tatsache, dass China diesen Markt (mehr als 90 Prozent der Weltproduktion) seit Jahren dominiert. Einige wenige Prozent "Seltene Erden"-Metalle in einer Legierung bedeuten oftmals schon eine erhebliche Verbesserung derselben. SE werden vielfältig eingesetzt: in Permanentmagneten, Elektronik, Katalysatoren, Keramik, Glas und vielem mehr. Kein Handy, kein iPad und kein Auto würden heute mehr ohne diese Metalle funktionieren. Sie sind fester Bestandteil fast aller elektronischen Produkte.
Recycling: Für die Seltenen Erden gibt es noch kein ausgereiftes Verfahren, um die Stoffe in großem Stil zurückzugewinnen. Entsprechend ist die Preisentwicklung eine entscheidende Variable, denn das Recycling ist gegenwärtig komplex, zeitaufwendig und noch wenig ergiebig.
Strategische Sondermetalle
Der Begriff Strategische Sondermetalle stammt aus der Finanzwelt und bezeichnet Metalle, die für die Herkunftsländer als Exportgut als auch für die verarbeitenden Länder wegen ihrer Anwendungen strategische Bedeutung haben. Auch geläufig ist der Begriff Nebenmetalle, da die Metalle in der Erdkruste recht selten auftreten und meist in Form einer „Nebenausbeute“ bei der Gewinnung von Blei, Zink, Kupfer und Aluminium anfallen. Beide Begriffe werden gleichwertig genutzt.
Zusammen mit den Seltenen Erden wird auch oft der Ausdruck „Technologiemetalle“ oder „Hightech-Metalle“ verwendet. Zu den strategischen Metallen gehören insgesamt 29 Elemente. Zu den bekanntesten und relevantesten Strategischen Sondermetallen gehören Antimon, Gallium, Hafnium, Indium und Kobalt. Sie sind essentieller Bestandteil beispielsweise in den Lithium-Ionen-Akkus der Mobilfunkgeräte (Kobalt), Photovoltaikanlagen (Indium, Gallium), Legierungen (Antimon) oder Laserköpfen (Hafnium).
Zumeist finden die Metalle ihre Verwendung in Form von Legierungen. Sie sind unverzichtbar für viele technische Anwendungen, aber auch für die Industrieproduktion an sich. Sie werden häufig in Keramikverbindungen eingesetzt, um eine höhere Hitzebeständigkeit, Härte oder auch thermische Leitfähigkeit zu erzielen.
T
TAUSCHÄHNLICHE UMSÄTZE
Ein Steuerthema des Schrotthandels ist der Tauschähnliche Umsatz. In der Entsorgungswirtschaft wird durch Erfüllung der Entsorgungsleistung grundsätzlich vom Entsorger eine sonstige Leistung im Sinne des Umsatzsteuerrechts erbracht. Ein Tauschähnlicher Umsatz liegt dann vor, wenn zusätzlich zur Baraufgabe als Gegenleistung eine Lieferung oder sonstige Leistung vereinbart wird.
Dies könnte der Fall sein, wenn Wertstoffe im Abfall enthalten sind, also Materialien, die mit positivem Marktwert weitergegeben werden können. Ob im Einzelfall das Prinzip des Tauschähnlichen Umsatzes anzuwenden ist, kann in der Regel über eine Reihe von Prüfschritten ermittelt werden. Dazu bietet der VDM das Prüfschema zum Tauschähnlichen Umsatz an.
U
Urban Mining
Urban Mining – die Rückgewinnung von Rohstoffen aus den Abfällen der Städte - spielt heute bei der nachhaltigen Nutzung von Metallen eine wichtige Rolle.
Rohstoffe sind ein knappes Gut, das durch das Wachstum der Weltbevölkerung immer begehrter wird. Umso wichtiger ist es, nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren und zu konsumieren. Dazu gehört auch, die Rohstoffe aus den Abfällen von Städten zurück zu gewinnen und so zu recyceln, dass daraus wieder neue Produkte, Gebäude oder Anlagen entstehen können. Das nennt man Urban Mining.
Die Recyclingunternehmen, die im VDM Mitglied sind, liefern durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zu Wiederverarbeitung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dabei wird die gesamte Palette im Kreislauf der Metalle von den Mitgliedsunternehmen des VDM abgedeckt. Dazu gehören Erfassung, Logistik, Aufbereitung, Sortierung und Handel.
Die Bedeutung von Urban Mining
Ein wichtiges Zukunftsthema des VDM und seiner Mitgliedsunternehmen ist das sogenannte Urban Mining. Da immer mehr Menschen in Städten leben, schreitet die Verstädterung (Urbanisierung) voran. Anthropogene Lager, also alle vom Menschen erzeugten und genutzten Produkte, wachsen stetig, während Lagerstätten an natürlichen Rohstoffen schrumpfen. Mittlerweile sind viele Ressourcen in größerem Umfang in Städten verbaut oder in Konsumgütern in Nutzung, als weltweit in Rohstoffvorkommen zu finden sind. Hier spricht man von urbanen, also städtischen, Minen.
Um Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu fördern, gilt es, diese urbanen Minen zu erschließen, die darin verborgenen Rohstoffe zu gewinnen und mit ihrer Hilfe einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf zu fördern. Folgende Beispiele zeigen die Bedeutung von Urban Mining: allein in Deutschlands Wohnbauten stecken 10,5 Milliarden Tonnen an mineralischen Baustoffen. In einem einzigen Windrad sind rund acht Tonnen Kupfer verarbeitet, bei großen Offshore- Anlagen bis zu 30 Tonnen. Für den Bau eines Elektrofahrzeugs werden etwa 100 Kilogramm Kupfer benötigt, rund doppelt so viel wie für einen herkömmlichen Mittelklassewagen. Der Aluminiumanteil in einem Pkw liegt heutzutage bei rund 160 kg Aluminium pro Auto – ein großer Teil kommt bereits aus recyceltem Aluminium. Vor allem in Haushalten gibt es noch ungeahntes Potential. Etwa zwei Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikschrott (E-Schrott) fallen pro Jahr in Deutschland an. Doch recycelt wird davon nur die Hälfte. Die andere Hälfte horten Verbraucher oder werfen sie in den Hausmüll.
Bisher finden die in langlebigen Gebrauchsgütern gebundenen Ressourcen nur begrenzt Berücksichtigung beim Recycling. Zwar nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle beim Metallrecycling ein und die Wiederverwertungsquoten sind so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt, dennoch geht bei den bekannten und eingesetzten Recyclingprozessen immer noch zu viel Material verloren. Umso wichtiger ist es, das Potenzial von Urban Mining auszuschöpfen, um diesen Verlust auszugleichen und Nachhaltigkeit zu fördern. Hierbei unterstützt der VDM seine Mitgliedsunternehmen und sensibilisiert sie für das Potenzial von Urban Mining.
Usancen und Klassifizierungen - Handelsregeln
Jede Branche braucht feste Regeln, die dem Handel zu Grunde gelegt werden, so natürlich auch im Metallhandel. Die Erarbeitung branchenüblicher Usancen und Klassifizierungen (UKM) war ein Grund für den Zusammenschluss des NE-Metallhandels im Verband Deutscher Metallhändler e.V. im Jahr 1908. Unter Usancen werden die in einer Branche üblichen Handelsregeln verstanden. Sie dürfen nicht mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verwechselt werden. Während AGB lediglich einen Teil der individuellen Vertragsgestaltung darstellen, beschreiben Usancen einen branchenweiten Grundkonsens. Im Laufe der Jahre wurden die Usancen und Klassifizierungen für den Metallhandel immer wieder überarbeitet und mit der Industrie abgestimmt. Die für den Metallhandel maßgeblichen Usancen wurden zuletzt 2002 dem Markt angepasst und dienen mittlerweile eher zur Orientierung.
ISRI Scrap Specifications
Die ISRI Scrap Specifications sind eine Reihe von Standards und Spezifikationen, die von der Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) entwickelt wurden. Die ISRI ist die führende Organisation der Metallrecyclingwirtschaft in den USA.
Die ISRI Scrap Specifications dienen als Referenz für den internationalen Handel mit Schrottmaterialien. Sie legen detaillierte Anforderungen für verschiedene Arten von Schrott fest, einschließlich Metallen, Kunststoffen, Papier, Elektronikschrott und anderen Materialien. Die Spezifikationen umfassen Aspekte wie Größe, Form, Reinheit, Verunreinigungen und andere Qualitätsmerkmale.
Die ISRI Scrap Specifications spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Transparenz, Qualität und Konsistenz im Metallrecycling. Sie bieten eine gemeinsame Sprache und einheitliche Standards für Käufer und Verkäufer von aufbereiteten Metallen weltweit. Durch die Einhaltung dieser Spezifikationen wird sichergestellt, dass die gehandelten Metalle den Anforderungen der Endverwerter und Verarbeitungsanlagen entsprechen.
Die ISRI Scrap Specifications sind ein wichtiges Instrument, um das Vertrauen in den internationalen Handel mit aufbereiteten Metallen zu stärken und eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu fördern. Sie tragen zur Förderung einer verantwortungsvollen Metallrecyclingwirtschaft bei, die Umweltauswirkungen reduziert und den Wert von recycelten Materialien maximiert
W
Bismut oder Wismut (historisch auch: Wismuth) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Bi und der Ordnungszahl 83. Im Periodensystem steht es in der 5. Hauptgruppe oder Stickstoffgruppe.
X
Y
Z
Zink ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Zn und der Ordnungszahl 30. Zink wird zu den Übergangsmetallen gezählt, nimmt aber darin eine Sonderstellung ein, da es wegen der abgeschlossenen d-Schale in seinen Eigenschaften eher den Erdalkalimetallen ähnelt. Nach der veralteten Zählung wird die Zinkgruppe als 2. Nebengruppe bezeichnet (analog zu den Erdalkalimetallen als 2. Hauptgruppe), nach der aktuellen IUPAC-Nomenklatur bildet Zink mit Cadmium, Quecksilber und dem ausschließlich in der Forschung relevanten Copernicium die Gruppe 12. Es ist ein bläulich-weißes sprödes Metall und wird unter anderem zum Verzinken von Eisen und Stahlteilen sowie für Regenrinnen verwendet. Zink ist für alle Lebewesen essentiell und ist Bestandteil wichtiger Enzyme. Der Name Zink kommt von Zinke, Zind („Zahn, Zacke“), da Zink zackenförmig erstarrt.